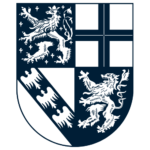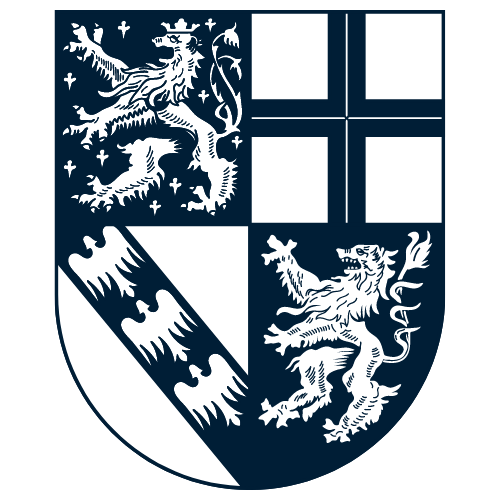Mit Wirkung zum 01.01.2024 tritt das Gesetz zur Modernisierung des Rechts der Personengesellschaften (MoPeG) in Kraft. Es bringt neben zahlreichen Neuregelungen zur „BGB-Gesellschaft“, der GbR, auch die Einführung eines neuen Registers mit sich: Das Gesellschaftsregister.
Dieses Register tritt eigenständig neben die bereits bestehenden Handels- und Transparenzregister. Es ermöglicht erstmals eine Eintragung der GbR, die dann verpflichtet ist, den Namenszusatz eGbR zu tragen. Die Eintragung ist grundsätzlich freiwillig und hat auf die Rechtsfähigkeit der GbR keinen Einfluss. Die mit der Eintragung einhergehende Publizität soll jedoch Erleichterungen im täglichen Rechtsverkehr mit sich bringen und eröffnet der eGbR zusätzliche Handlungsmöglichkeiten.
Mit der Möglichkeit einer eigenständigen Eintragung als eGbR müssen in anderen Registern nicht mehr die jeweiligen GbR-Gesellschafter eingetragen werden, sondern die GbR selbst als eigenständiges Rechtssubjekt. Änderungen im Gesellschafterbestand werden nur noch im Gesellschaftsregister nachvollzogen.
Besteht eine Eintragungspflicht?
Trotz „Freiwilligkeit“ der Eintragung können die folgenden Voreintragungserfordernisse einen faktischen Eintragungszwang auslösen. Dann ist ohne die Anmeldung zum Gesellschaftsregister eine Eintragung im Grundbuch oder im Handelsregister nicht möglich.
Für eine bereits im Grundbuch als Rechtsinhaber eingetragene GbR besteht nur insofern ein Bestandsschutz, als dass die GbR auch ohne Registrierung im Gesellschaftsregister bestehen bleiben kann. Eine nicht im Gesellschaftsregister eingetragene GbR kann jedoch ab dem 01.01.2024 keine Immobilie mehr erwerben oder veräußern. Insofern bestehen grundbuchrechtliche Voreintragungserfordernisse bei Erwerb und Veräußerung von Grundstücken durch die GbR und bei sämtlichen Rechten, deren Begründung oder Übertragung im Grundbuch einzutragen sind.
Bei Beteiligung einer GbR als Gesellschafterin an anderen Gesellschaften ist zwischen der auch ohne Eintragung materiell-rechtlichen Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts und der registerrechtlichen Behandlung der GbR als Gesellschafterin zu unterscheiden. So ist etwa bei Erwerb oder Veräußerung von Geschäftsanteilen an einer GmbH die eingereichte Gesellschafterliste zurückzuweisen, wenn die veräußernde bzw. erwerbende GbR nicht bereits im Gesellschaftsregister eingetragen ist.
Auch bei einem Gesellschafterwechsel besteht eine Eintragungspflicht einer im Grundbuch eingetragenen GbR.
Sonstige Vorteile der Eintragung
Selbst wenn Ihre GbR nicht von einem faktischen Eintragungszwang betroffen ist, bietet die Eintragung weitere Vorteile:
- Nur die eGbR genießt freies Sitzwahlrecht, d.h. sie kann einen vom Verwaltungssitz abweichenden Gesellschaftssitz haben.
- Die Vertretungsbefugnis der Gesellschafter einer eGbR hat Registerpublizität.
- Die eGbR wird umwandlungsfähige Gesellschaft und kann nach den Regeln des Umwandlungsgesetzes umgewandelt werden.
- Der eGbR wird ein identitätswahrender Rechtsformwechsel hin zu einer Personenhandelsgesellschaft oder einer Partnergesellschaft ermöglicht (sog. Statuswechsel).
Wie läuft die Eintragung ab?
Die Anmeldung der GbR zum Gesellschaftsregister bedarf der Mitwirkung aller Gesellschafter. Hiervon kann auch nicht im Gesellschaftsvertrag abgewichen werden. „Unwillige“ Gesellschafter kann eine Mitwirkungspflicht treffen, wenn ein Voreintragungserfordernis besteht und daher bei unterbleibender Eintragung die Handlungsunfähigkeit der GbR droht. Im Übrigen gelten die zur Anmeldung im Handelsregister maßgeblichen Bestimmungen entsprechend. Die Anmeldung muss in öffentlich beglaubigter Form erfolgen. Sie bedarf also der notariellen Mitwirkung.
Die technische und administrative Ausgestaltung des Gesellschaftsregisters wurde den einzelnen Bundesländern überlassen.
Wie sichere ich die rechtliche Handlungsfähigkeit meiner bestehenden GbR zum 01.01.2024 ab?
Zunächst einmal ist die Eintragung für die Rechtsfähigkeit nicht erforderlich. Sie hat eine rein deklaratorische Wirkung. Auch eine etwa bereits im Grundbuch eingetragene GbR bleibt dort eingetragen.
Relevant wird eine zeitige Eintragung der GbR jedoch in den Fällen, in denen eine (Vor-)Eintragungsobliegenheit ins Gesellschaftsregister vor der Vornahme von Rechtshandlungen besteht.
Da das MoPeG keine Übergangsfrist zulässt und auch keine Eintragung bereits vor dem 01.01.2024 beantragt werden kann, ist mit einem großen Andrang zu rechnen, der zu erheblichen Verzögerungen bei der Eintragung führen könnte. Daher ist GbR-Gesellschaftern zu raten, bereits frühzeitig zu prüfen, ob für ihre GbR eine der vorgenannten mittelbaren Eintragungspflichten besteht. Falls ja, sollten bereits absehbare Änderungen des Gesellschafterbestandes, im Grundeigentum und anderen grundstücksgleichen Rechten sowie in der Beteiligung an anderen Gesellschaften möglichst noch im laufenden Jahr 2023 abgeschlossen werden.
Zumindest sollte eine Vormerkung im Grundbuch eingetragen werden: Wird eine Vormerkung zeitlich vor dem 01.01.2024 ins Grundbuch eingetragen bzw. beantragt und bewilligt, gilt für die Erfüllung der mit der Vormerkung gesicherten Ansprüche das bisher geltende Recht. Nur so kann auch eine (noch) nicht registrierte GbR wirksam verfügen.
Bleibt die Steuerbefreiung von Grundstücksübertragungen unter Beteiligung einer eGbR bestehen?
Ein steuerrechtliches Problem stellt sich für die eGbR mit Inkrafttreten des MoPeG im Bereich der Grunderwerbsteuer. Gemäß §§ 5 und 6 GrEStG wird die Grunderwerbsteuer nicht erhoben, wenn ein Grundstück von einer Gesamthandsgemeinschaft auf eine beteiligungsidentische Bruchteilsgemeinschaft übertragen wird und umgekehrt. Unter diesen Begriff der Gesamthand wurde bislang auch die GbR gefasst. Mit Wirkung zum 01.01.2024 werden nun aber die dieser Sichtweise zugrundeliegenden Vorschriften im BGB geändert. Im neuen § 713 BGB wird klargestellt, dass die rechtsfähige GbR über ein eigenes Gesellschaftsvermögen verfügt. Der Begriff der Gesamthand spielt fortan im Gesellschaftsrecht keine Rolle mehr.
Dies verunsichert mit Blick auf den aktuellen Wortlaut der §§ 5, 6 GrEStG die Rechtspraxis. Die Personengesellschaften – und damit neben der GbR auch die oHG und die KG – werden aus dem Anwendungsbereich der steuerbefreienden Tatbestände herausfallen.
Der Gesetzgeber hatte jedoch bereits in der Begründung zum MoPeG deutlich gemacht, keine steuerrechtlichen Änderungen herbeiführen zu wollen. Die sich mit Inkrafttreten des MoPeG ergebende Widersprüchlichkeit verpflichtet den Gesetzgeber, noch bis Jahresende klare Verhältnisse zu schaffen. Ob dies gelingt, ist fraglich.
Der Diskussionsentwurf des Bundesfinanzministeriums zur Novellierung des Grunderwerbsteuergesetzes befindet sich derzeit in der Bund-Länder-Abstimmung. Im aktuellen Regierungsentwurf zum Wachstumschancengesetz (Stand: 02.10.2023) würden die Steuerbegünstigungen zwar wegfallen, es wurde jedoch klargestellt, dass die Gespräche mit den Ländern über die künftige Ausgestaltung von Steuerbefreiungen noch nicht abgeschlossen sind. Bis jetzt wurde lediglich eine Regelung eingefügt, wonach der alleinige Wegfall des Gesamthandvermögens nicht zu einer Verletzung laufender Behaltensfristen führt. Dies schafft jedoch lediglich Rechtssicherheit für bis zum 31.12.2023 verwirklichte Transaktionen. Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Mindestbesteuerungsgesetz hat der Finanz- und Wirtschaftsausschuss des Bundesrates eine Änderung in der Abgabenordnung vorgeschlagen, mit welcher verhindert werden soll, dass die Steuerbefreiungen in § 5 Abs. 1 und 2, § 6 Abs. 3 Satz 1 und § 7 Abs. 2 GrEStG ins Leere laufen.
Für Immobilien-Transaktionen im Zusammenhang mit Personengesellschaften ab dem 01.01.2024 bleibt es also weiterhin spannend. Es gilt, die Entwicklung der drei Gesetzesvorhaben genau im Blick zu behalten.